
Die Universitätsmedizin Rostock, die Rostocker NeuroProof Systems GmbH und das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (FhG-IZI) haben ein gemeinsames Forschungsprojekt gestartet, um die biologischen Ursachen des Long- und Post-COVID-Syndroms besser zu verstehen. Ziel der Kooperation ist es, herauszufinden, ob und in welchem Maße Antikörper im Blut von Patienten die Aktivität von Nervenzellen beeinflussen. Das Vorhaben wird im Rahmen des Projektes COVICare-M-V durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert.
COVID-19 kann bei einem Teil der Erkrankten zu einem Long- oder Post-COVID-Syndrom führen, das mit anhaltender Erschöpfung, Schwäche und Belastungsintoleranz verbunden ist. Die Diagnostik gestaltet sich schwierig, da bislang kaum objektivierbare Biomarker existieren. Dies erschwert die medizinische Einordnung und führt häufig dazu, dass Betroffene sich mit ihren Beschwerden nicht ausreichend anerkannt sehen und zielgerichtet behandelt werden können.
Ein möglicher Behandlungsansatz ist die extrakorporale Blutwäsche, bei der überschüssige Antikörper aus dem Blut entfernt werden. Einige Patienten, bei denen dieser Ansatz bereits durchgeführt wurde, berichten über positive Effekte. Doch bisher ist unklar, welche Antikörper beteiligt sind und wie stark sie zur Krankheitsentstehung beitragen.
Prof. Dr. Steffen Mitzner, Leiter der Sektion Nephrologie in der Klinik und Poliklinik für Infektiologie, Nephrologie, Endokrinologie und Tropenmedizin an der Universitätsmedizin Rostock und FhG-IZI-Standortleiter in Rostock, betonte, dass es bei dem Projekt darum gehe, die biologischen Grundlagen der Erkrankung besser zu verstehen und objektive Nachweise für beobachtete Effekte zu schaffen. „Wir wollen prüfen, ob die Veränderungen, die Patienten nach einer Blutwäsche beschreiben, auch auf zellulärer Ebene messbar sind“, sagte er. Die Zusammenarbeit mit NeuroProof ermögliche es, klinische Beobachtungen mit präzisen neurophysiologischen Messungen zu verbinden.
Im Rahmen des Projekts soll untersucht werden, ob Antikörper aus dem Blut von Patienten die neuronale Aktivität in Zellkulturen beeinflussen. Die NeuroProof Systems GmbH verfügt über umfangreiche Erfahrung im Screening von Substanzen in neuronalen Zellkulturen und misst dabei die elektrische Aktivität von Nervenzellen, um Rückschlüsse auf deren Funktion zu ziehen.
Prof. Dr. Emil Reisinger, Projektleiter von COVICare-M-V, erklärte, dass die Kombination aus klinischer Expertise und neurobiologischer Forschung einen wichtigen Schritt darstelle, um Long-COVID besser zu verstehen. Wenn sich zeigen lasse, dass Blutproben nach einer Blutwäsche weniger hemmend auf Nervenzellen wirken, wäre das ein wichtiger Hinweis auf die Wirksamkeit der Behandlung.
Dr. Olaf Schröder, CEO der NeuroProof Systems GmbH, sagte, erste Vorversuche seines Unternehmens hätten bereits darauf hingedeutet, dass bestimmte Antikörper die Aktivität von Nervenzellen deutlich dämpfen könnten. Ziel der Kooperation sei es nun, diese Zusammenhänge wissenschaftlich zu überprüfen und zu belegen. Die NeuroProof Systems GmbH betreibt internationale Vertragsforschung im Bereich neuroaktiver Substanzen und arbeitet mit Partnern in Asien, Europa und Nordamerika zusammen.
Die Long-COVID-Spezialsprechstunde an der Klinik und Poliklinik für Infektiologie, Nephrologie, Endokrinologie und Tropenmedizin der Universitätsmedizin Rostock besteht seit 2020 und wurde angesichts der wachsenden Zahl an Betroffenen kontinuierlich weiterentwickelt. Dort betreut ein interdisziplinäres Team Patientinnen und Patienten mit Long-COVID, Post-VAC-Symptomen und Langzeitfolgen anderer Virusinfektionen in enger Zusammenarbeit mit der Pneumologie, Kardiologie, Allgemeinmedizin, Psychologie und Physiotherapie.




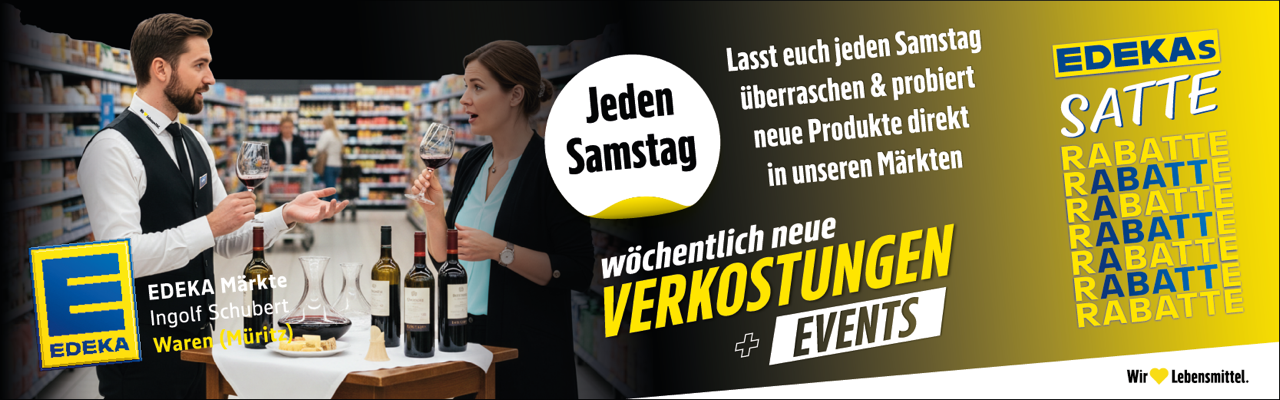


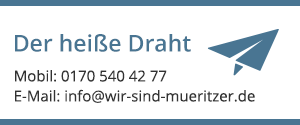


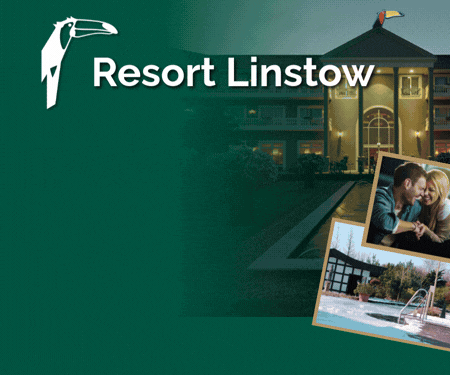
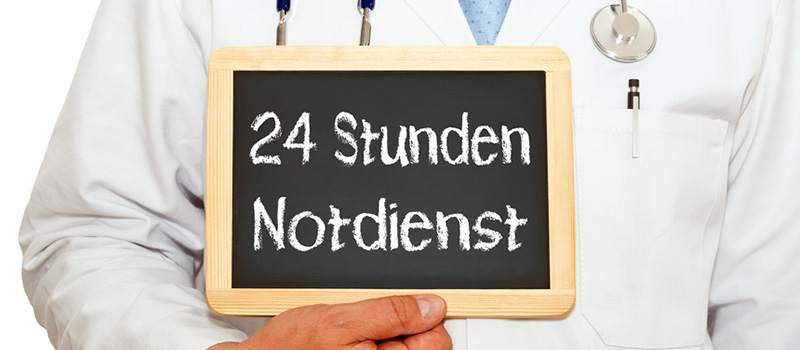
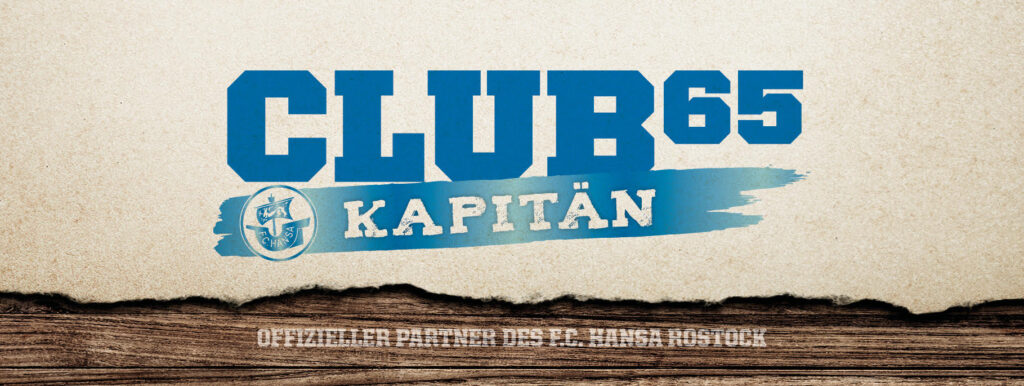

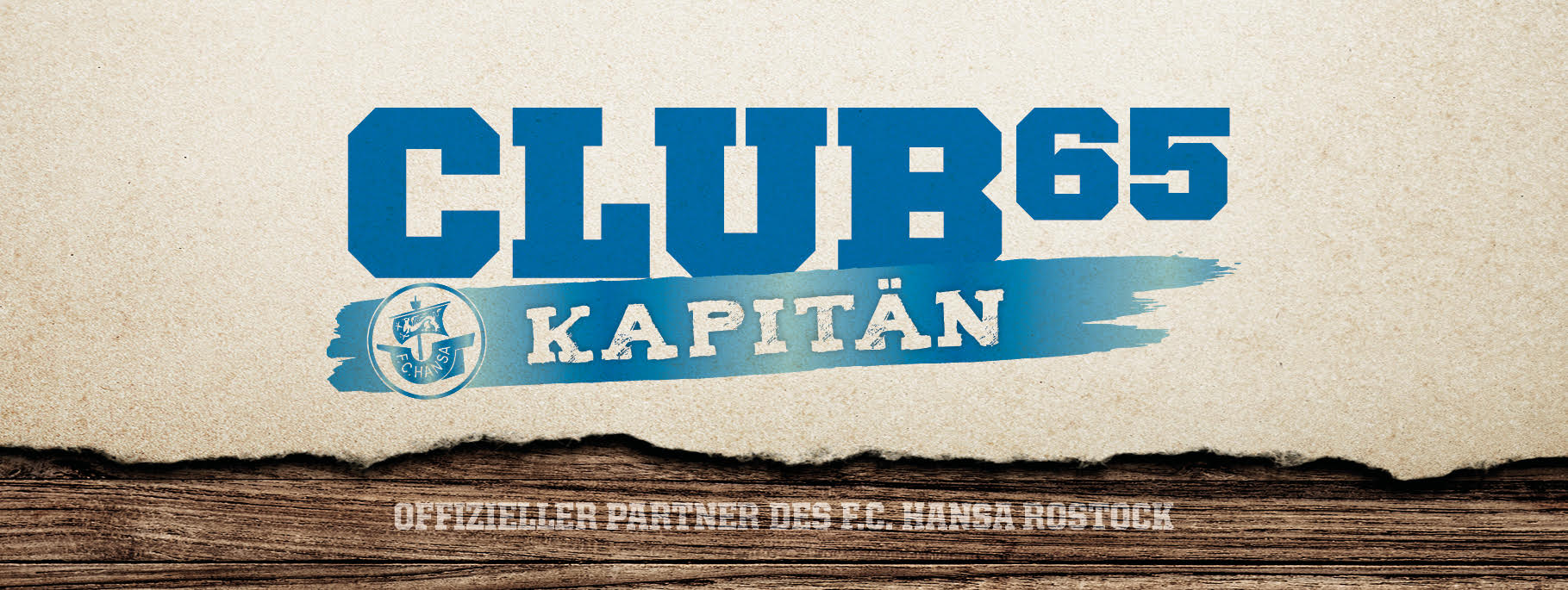
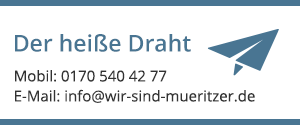
Neueste Kommentare